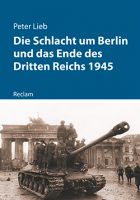Zweiter Weltkrieg
Fritsche, Maria, Prof. Dr.
Zweiter Weltkrieg; Wehrmacht; Militärgerichtsbarkeit; Deserteure; Norwegen unter deutscher Besatzung; Film; Wehrmachtkinos; Kriegserinnerung
Holliday, Jake
Partisanen-/Bandenbekämpfung und Besetzung in der UdSSR; Frontkämpfer an der Ostfront; Nachkriegszeit Bewaffnete Organe.