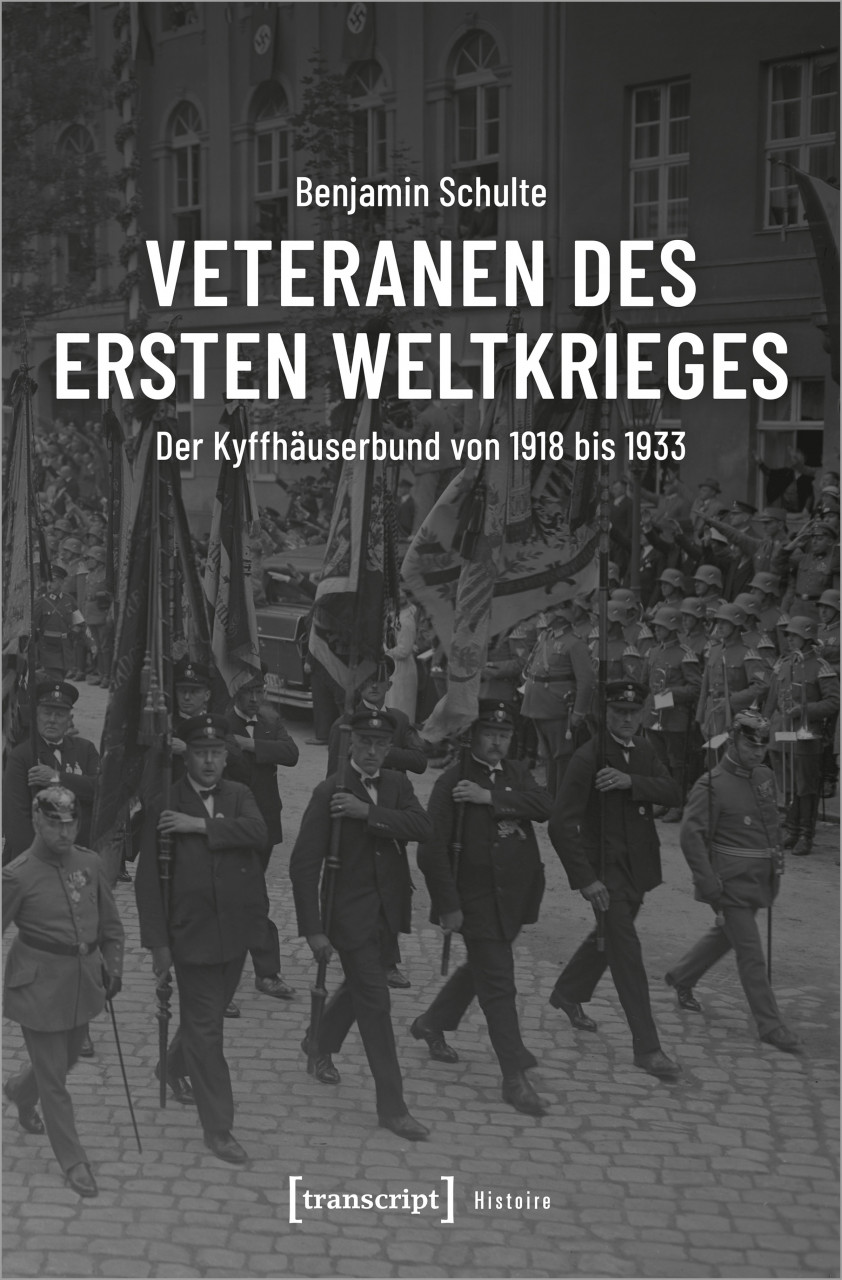Der Kyffhäuserbund e.V. sieht sich in einer über 230 Jahre alten Traditionslinie seit seiner Gründung im Todesjahr Friedrichs des Großen 1786. Heute widmet sich der 1952 wiedergegründete Verband der Reservistenarbeit und dem Schießsport. Dabei agierte er lange im Grenzbereich des organisierten Nationalismus der Bundesrepublik.[1]
Nun wurde erstmals die Rolle des Kyffhäuserbundes bei der Konstruktion des Veteranen untersucht. Benjamin Schulte hat die vielfältige Verbandspublizistik, von Periodika bis hin zur Belletristik aus dem hauseigenen Verlag, einer systematischen Betrachtung unterzogen. Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um die überarbeitete Fassung seiner an der Universität zu Köln eingereichten Dissertation.
Die diskursive Figur des Veteranen ist für die Zeit der Weimarer Republik zentral. Mit Benjamin Ziemann wird die Weimarer Republik als „Möglichkeitsraum“[2] begriffen, „in dem Gegenwart und Zukunft […] vor dem Hintergrund der Vergangenheit gestaltet wurden.“ (S. 34) Das Gros der wissenschaftlichen Literatur zu den Veteranenverbänden behandelt die parteipolitischen Vereinigungen, deren paramilitärischer Charakter das Bild der politischen Gewalt zwischen den politischen Lagern prägt. Der Kyffhäuserbund hingegen geriet in Vergessenheit. Dabei übernahm er eine „doppelte Scharnierfunktion“ (S. 27) als Kommunikationsglied der ehemaligen Weltkriegssoldaten untereinander und in der Durchsetzung des eigenen Veteranenbildes gegen konkurrierende Deutungen. Schulte geht daher der Frage nach, inwiefern es sich bei dem Verband um einen vermeintlich unpolitischen Anwalt der eigenen Klientel handelte oder um eine politische Interessenvertretung.
Mit der Abdankung des Kaisers und dem Ende der Monarchie verlor der Verband nicht nur seine Monopolstellung, die er bis dahin inne gehabt hatte. Er musste auch sein Wertesystem neu justieren. Der neue Ehrenpräsident Paul von Hindenburg beförderte mit dem propagierten Feindbild des Bolschewismus die Neuausrichtung. Gleichzeitig unterstützte der Kyffhäuserbund die Demobilisierung der Frontsoldaten und damit ihre Reintegration in Friedensalltag und Wirtschaft und wirkte so auf eine Stabilisierung des inneren Friedens hin, verteidigte diesen jedoch auch mit paramilitärischer Gewalt, denn Mitglieder wurden regelrecht ermuntert, in den Freikorps gegen kommunistische Aufstände vorzugehen. Dabei hatte die Frage der Konsolidierung auch einen ganz pragmatischen Hintergrund, denn mit dem einsetzenden Mitgliederschwund ging die Gefährdung der ökonomischen Stabilität des Verbandes einher, der 1926 noch etwa 2,5 Millionen Mitglieder zählte.
Während das erste Kapitel diese ‚Vorgeschichte‘ erläutert, befasst sich das zweite Kapitel mit den auch vom Kyffhäuserbund kolportierten „weltkriegsimmanente[n] Narrative[n]“ (S. 65). Der Verband opponierte gegen den Versailler Friedensvertrag und entwickelte publizistische Aktivität zur Ehrenrettung des Frontsoldaten. Folgerichtig hatte er eigene Vorstellungen, wie der Weltkriegsroman auszusehen hätte. Dieser sollte authentisch und in seiner Sprache klar sein, außerdem hätte er sich jeder politischen und moralischen Meinung zu entziehen. Ebenso engagierte man sich im Bereich des Spielfilms. Um in den Kriegervereinen Lichtbild- und Filmabende durchzuführen, initiierte man eine Wanderlichtspielbewegung, mit der eigens eine Film-Abteilung betraut wurde.
Ausführlicher behandelt der Autor die verschiedenen zentralen Denkmalinitiativen des Kyffhäuserbundes: Das im Harz bereits 1896, in einer Zeit des Denkmalkultes, eingeweihte Kyffhäuser-Denkmal diente als Vorbild für neue Denkmalareale. Seit 1920 beteiligten sich neben dem Kyffhäuserbund unter anderem das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und der Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten an den nie realisierten Planungen für ein Reichsehrenmal. So ungewöhnlich dieser illustre Kreis der Veteranenverbände war, so schlecht stand es um den von der Reichsregierung initiierten Denkmalsbau. Zunächst stritt man über den geeigneten Standort, dann drohte ein Konkurrenzprojekt. Das 1927 in Ostpreußen eingeweihte Tannenberg-Denkmal war durchweg durch Spenden finanziert worden. Tatsächlich eignete sich der eine sakrale Aura ausstrahlende, monumentale Bau besser, das nationale Selbstverständnis zu transportieren, als das republikanische Reichsehrenmal, mit dem der Kriegsopfer gedacht werden sollte. Noch 1933 war das Reichsehrenmal nicht umgesetzt und wurde unter den Nationalsozialisten nicht weiterverfolgt. In Bezug auf das in Düsseldorf 1928 eingeweihte Denkmal für das Niederrheinische Füsilierregiment Nr. 39, dieses „steinerne Unglück“ (zit. nach S. 111), war sich der Kyffhäuserbund mit der öffentlichen Meinung einig. Nach der NS-Machtübernahme wurde das Denkmal schließlich abgerissen.
Im dritten Kapitel zeichnet der Autor nach, wie der Verband in das tagespolitische Geschäft eingriff. Einerseits zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet, bezog er andererseits – insbesondere unter seinem neuen Präsidenten Rudolf von Horn ab 1926 – immer häufiger Position in innen- wie außenpolitischen Kontroversen. Dabei sah sich die Verbandsführung dem Druck der Parteien von rechts und links ausgesetzt und wollte zugleich die Erwartungen der Mitglieder nicht enttäuschen.
Beschäftigt man sich mit Veteranen nach dem Ersten Weltkrieg, kommt das Problem der Kriegsversehrten folgerichtig auf. Thematisiert wird daher auch die „Politisierung des kriegsversehrten Soldatenkörpers“ (S. 173) durch den Veteranenverband. Auch ein beschädigter Körper konnte in den Augen der Verbandsvertreter wieder tauglich gemacht werden. So schuf man ein engmaschiges Fürsorgenetzwerk und animierte Arbeitgeber dazu, Kriegsbeschädigte einzustellen. Zu Fürsorgezwecken wurde sogar der Verband deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegshinterbliebener als eigenständige Organisation gegründet. Kein Verständnis hatte man hingegen für bettelnde Veteranen, widerspreche das Betteln doch der ‚Ehre‘ des Frontsoldaten. Ebenso hatten heroische Männlichkeit wie hegemoniale Vaterfigur nach dem Krieg gelitten, weswegen der Verband verstärkte Anstrengungen in der Stärkung der Veteranenfamilie unternahm. Um „auch der Frau ein Plätzchen im ‚Kyffhäuser‘ zu geben“ (zit. nach S. 187), wie es hieß, wurde eine eigene Zeitungsrubrik Die deutsche Frau ins Leben gerufen.
Die Arbeit des Kyffhäuserbundes war nicht nur auf den vergangenen Krieg bezogen, wie der Autor im vierten Kapitel ausführt. Man richtete sein Augenmerk zunehmend auf die Vorbereitung für den Krieg der Zukunft, indem man die Technisierung und Spezialisierung des Militärwesens propagierte. Das Massenheer sollte der Vergangenheit angehören. Gleichzeitig wurde der Einsatz von Giftgas als humanes und effizientes Kriegsmittel propagiert. Trotz derartiger Bemühungen litt der Kyffhäuserbund unter dem Fehlen einer „corporate identity“ (S. 229). Er wurde zum „organisatorischen Auslaufmodell“ (S. 237). Der Verband drohte zwischen den paramilitärischen Verbänden der verschiedenen politischen Strömungen regelrecht aufgerieben zu werden und suchte nach einer Positionierung. Diese meinte man in der Kreation einer „Volkskameradschaft“ (zit. nach S. 232) gefunden zu haben. Dabei entfernte sich der Verband jedoch zusehends von dem republikanischen Boden, auf dem er ohnehin stets nur sehr unsicher gestanden hatte. Beispielsweise kam es zu Zusammenstößen zwischen Kyffhäuser-Jugendbund und Rotem Frontkämpferbund. Schulte geht auf derlei gewaltsame Ausformungen jedoch ebenso wenig ein wie auf die 1930 erfolgte Bildung der Deutschen Front. In der Lesart Schultes erscheint der Kyffhäuserbund mehr als Getriebener der politischen Radikalisierung am Ende der Weimarer Republik denn als Akteur, der mit seinem Nationalismus die gesellschaftliche Spaltung selbst voran trieb. Dabei fand bereits Karl-Christian Führer in seinem 1984 in den Militärgeschichtlichen Mitteilungen erschienenen Aufsatz klare Worte, indem er dem Kyffhäuserbund einen „ungebrochen gepflegten extremen Nationalismus“[3] attestierte.
Die NS-Machtübernahme veränderte auch das Gesicht des Kyffhäuserbundes, der sich von Anfang an vorbehaltlos in den Dienst des NS-Regimes stellte. Im Gegensatz zum Nationalsozialistischen Deutschen Frontkämpferbund (NSDFB, vormals Stahlhelm) konnte sich der Kyffhäuserbund seine Eigenständigkeit erhalten. Im Verlauf der 1930er Jahre konkurrierte er – nun unter dem Namen Deutscher Reichskriegerbund – mit der in der Studie von Nils Löffelbein bereits untersuchten Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung (NSKOV)[4] um Kompetenzen und Einfluss in den Bereichen der Veteranen- und Kriegsversehrtenfürsorge. Auf das weitere Wirken des Kyffhäuserbundes im Nationalsozialismus und sein Konkurrenzverhältnis zu anderen Organisationen, die ebenso um die Gunst der Veteranen buhlten, geht der Autor im abschließenden Kapitel leider nur noch kursorisch ein – quasi als Nachgeschichte, in der der Veteranenverband seine endgültige Abwicklung findet. Durch die Unterordnung im Machtbereich Heinrich Himmlers versuchte der Kyffhäuserbund schließlich dem Absinken in der Bedeutungslosigkeit zu entkommen. Der drohenden Auflösung im Kriegsverlauf wollte der 1934 zum neuen Bundesführer ernannte Wilhelm Reinhard durch Verschlankungsmaßnahmen begegnen. Am 30. Juni 1943 wurde der Verband endgültig aufgelöst, sein Vermögen in eine Stiftung übertragen. Die Mitglieder der Kriegervereine unterstanden fortan der Parteiführung und dienten zum Kriegsende im Volkssturm.
Insgesamt bleibt der fade Beigeschmack, dass das Buch zwar viele Aspekte aufgreift, aber nicht immer tiefgreifend analysieren kann. So geht Schulte auf den transnationalen Austausch der Veteranen nicht näher ein. Mit ausländischen Veteranenverbänden unterhielt der Kyffhäuserbund Kontakte und hatte zu diesem Zweck eine Auslandsabteilung aufgebaut. Besonders intensiv war der Kontakt ab Ende der 1930er Jahre und während des Zweiten Weltkrieges zu dem japanischen Pendant. Eine beeindruckende Fotografie aus dem Jahr 1937, die einen Marsch von Kyffhäuserbund-Mitgliedern zusammen mit US-amerikanischen Veteranen beim Durchschreiten des Brandenburger Tors in der Reichshauptstadt zeigt, wird zwar abgedruckt, aber vom Autor nicht weiter beachtet. Auch sonst werden die gewählten Abbildungen nur selten als eigenständige Quellen analysiert und dienen oft lediglich der Illustrierung.
Der Kyffhäuserbund erscheint in Schultes Studie merkwürdig unverbunden zu anderen Akteuren des nationalistischen Spektrums. Ebenso fehlt aufgrund des gewählten Zugangs über die Verbandspublikationen die Mitgliederebene. So erfahren wir nicht, wie die Arbeit der Verbandsspitze in den lokalen Kriegervereinen aufgenommen wurde und wie diese selbst den Verband konkret beeinflussten. Trotzdem ist die Studie ein weiterer Baustein in der Kulturgeschichte des Veteranen.
Benjamin Schulte, Veteranen des Ersten Weltkrieges. Der Kyffhäuserbund von 1918 bis 1933, transcript Verlag: Bielefeld 2020, 304 S., 25 Abb., 55,00 €, ISBN 978-3-8376-5089-1.