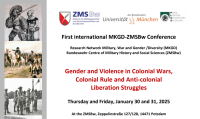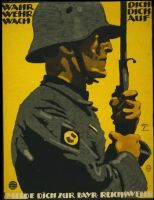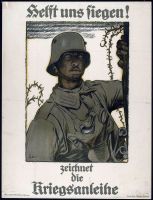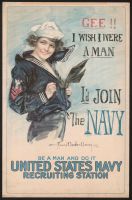20. Jahrhundert (allg.)
Rajković, Zvonimir
Österreich-Ungarn, k.u.k. Streitkräfte, k.u.k. Kriegsmarine, U-Boot-Krieg im Ersten und Zweiten Weltkrieg und U-Boot-Kriegsführung in der Zeitgeschichte und Gegenwart, Gebirgskrieg, Afrikafeldzug
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »