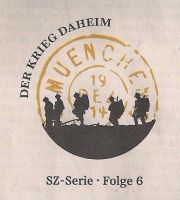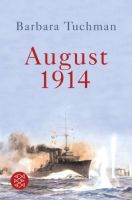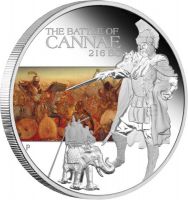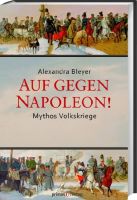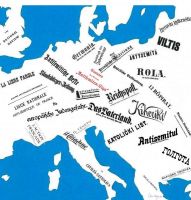Europa (allg.)
Brossier, Dominique Pascal, M.A.
Neuzeithistoriker für Militärgeschichte 1789 bis zur Gegenwart mit Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg.
B.A.-Arbeit: Keine Soldaten wie andere auch. Franzosen in der Waffen-SS.
M.A.-Arbeit: Gigantomanie und Missmanagement im deutschen Panzerbau 1941-1945. Eine Fallstudie anhand des Panzerkampfwagens „Maus“.
Quadflieg, Peter M., Dr.
Forschungsinteressen:
Archivwissenschaften
Brüche und Kontinuitäten im Übergang der Herrschaftssysteme in Deutschland.
Die historische Biographie als Mittel der sozialgeschichtlichen Forschung.
Geschichte der BeNeLux-Staaten im 19. und 20. Jahrhundert.
Geschichte des Gebiets der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG).
Wirtschaftsgeschichte der deutschen Besatzungsgebiete in Westeuropa.
Außen- und Außenhandelsgeschichte des „Dritten Reiches“.
Leukel, Patrick, M.A.
Reichsheer; Kommunikation; Netzwerk; Militärgeschichte; Adel; Fürsten; Spätmittelalter; 15. Jahrhundert; 16. Jahrhundert; Fehde; Neusser Krieg;