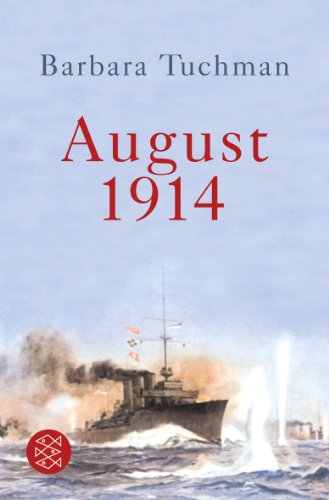Barbara Tuchman, August 1914, Fischer Taschenbuch, 2. Aufl. Frankfurt/Main 2013, 528 S., 12,99 €, ISBN-13: 978-3596197347
Das 1962 publizierte Buch von Barbara Tuchman ist aus zweierlei Gründen noch immer lesenswert: Es verweist auf langfristige Verwerfungen des Ersten Weltkrieges und zeigt die Unschärfe vieler aktueller Publikationen zum Thema. Dass Barbara Tuchman uns heute noch etwas zu sagen hat, irritiert auf den ersten Blick. „August 1914“, 1962 in den USA erschienen und zwei Jahre später auch in Deutschland verlegt, ist in vielerlei Hinsicht antiquiert. Beispielsweise erfährt man nichts über die Alltagsgeschichte des Krieges oder dessen transnationale Verflechtungen. Befremdlich ist auch die Nonchalance, mit der sie sich einer eingehenden Darstellung Österreich-Ungarns entledigt; oder dass sie die Julikrise nur in groben Zügen skizziert, obwohl die relevanten Quellen bereits zu ihrer Zeit nahezu vollständig zur Verfügung standen. Trotzdem: „August 1914“ gilt zu Recht als Klassiker, weil die Autorin Sichtachsen in einem diskursiv überwucherten Terrain freilegt.
Im Zentrum des Buches stehen die übersteigerte Angst vor einer Entwertung militärischer Machtmittel; die nicht minder maßlose Sorge vor dem Verlust politischer Glaubwürdigkeit; und schließlich der Unwille oder die Unfähigkeit, einen einmal eingeschlagenen Kurs trotz erkennbar ruinöser Kosten zu korrigieren. Damit wird das Jahr 1914 als Fluchtpunkt markiert: einerseits als Kulmination weit in das 19. Jahrhundert zurückreichender Traditionslinien, andererseits als Ursprung von Verwerfungen, die auch ein Jahrhundert später noch für Irritationen sorgen.
Deutlicher und in jedem Fall früher als andere Historiker arbeitet Tuchman heraus, wie Europa zur Bühne eines Überbietungswettbewerbs um Kriegskompetenz wurde, begleitet von der Versuchung, diese Kompetenz bei günstiger Gelegenheit auch praktisch unter Beweis zu stellen. Als Militärmacht nicht ernst genommen zu werden, war eine auf allen Seiten verbreitete Phobie: Frankreich führte ein nicht enden wollendes Selbstgespräch über die Schmach von 1870/71, Russland wollte partout die Niederlage gegen Japan vergessen machen, Großbritannien fürchtete, keine Mittel gegen eine hegemoniale Neuordnung des europäischen Festlands aufbieten zu können, Österreich-Ungarn deutete die Unruhen an der Peripherie des Vielvölkerstaates als provokante Herausforderung ums Ganze – und das kaiserliche Deutschland pflegte Ohnmachtsphantasien im schrillen Wehklagen über seine angebliche Einkreisung.
Dennoch liest sich das Buch wie eine Gegenrede zur heute populären These der auf allen Schultern gleichmäßig verteilten Verantwortung für den Kriegsausbruch. Gewiss – auch Tuchman lässt keinen Zweifel daran, dass in der Julikrise alle Seiten unverantwortlich handelten. Überall gaben Politiker den Ton an, die weder ein Gespür für die eigensinnigen Konsequenzen ihres Handelns noch die Bereitschaft mitbrachten, sich in die Lage von Konkurrenten und Gegnern zu versetzen. Ob bei Hofe oder in Staatskanzleien – die meisten verhielten sich wie Zocker, erhöhten das Risiko, glaubten, die Gefahr beherrschen zu können, weil eine Politik des stetig erhöhten Einsatzes ja auch in der Vergangenheit gut gegangen war.
Aber die Politik des deutschen Kaiserreichs wird dadurch in ihrer Überheblichkeit oder Dummheit nicht relativiert. Als Berlin am 5. Juli seinem österreichischen Bündnispartner die bedingungslose Unterstützung zugesagt und sich mit diesem Blankoscheck der Handlungslogik Wiens unterworfen hatte, erklärte es zugleich einen Abgesang auf die Diplomatie. Damit kam ein riesiger Stein ins Rollen, wurde eine kaum steuerbare Dynamik ausgelöst. Kontingenz? Zufall? Verkettung unglücklicher Umstände? Wohl kaum. Die einschlägigen Synonyma verblassen allesamt vor einem so altmodischen wie zeitlosen Begriff: Verantwortung.
Gleichermaßen souverän positioniert sich Tuchman im Dauerstreit über die Frage, ob man mit einem langen oder kurzen Krieg rechnete, wie groß also die Risikobereitschaft tatsächlich war. Etwas zu sehen, so ihre gut abgesicherte Beobachtung, heißt noch lange nicht, es zu verstehen. Damit formulierte sie eine These, deren Plausibilität auch im Licht heutiger Forschung nicht verblasst ist: Wäre den Akteuren des Sommers 1914 tatsächlich klar gewesen, welche Art von Krieg sie riskierten – sie hätten die Notbremse gezogen.
Von bleibendem Wert ist nicht zuletzt die Reflexion der vom Ersten Weltkrieg ausgehenden Verwerfungen. Tuchman spielte mit keinem Wort auf die Konfrontation der Supermächte nach 1945 an. Und doch war offensichtlich, dass ihre Lesart des Jahres 1914 unter dem Eindruck des Kalten Krieges stand und dass sie umgekehrt mit dem Blick in die Vergangenheit das politische Terrain ihrer eigenen Zeit kartographieren wollte.
Im Vorwort zu einer Wiederauflage machte sie 1988 den bis dahin unverständigen Teil des Publikums auf diese hintergründige Absicht aufmerksam. Noch deutlicher äußerte sich John F. Kennedy. Nach der Kuba-Krise vom Oktober 1962 verschenkte er das Buch an enge Berater und ausländische Staatschefs, beeindruckt von Tuchmans Sichtachsen und ihrer Warnung vor einem durch Selbstüberschätzung, Leichtsinn und Ignoranz herbeigeführten Flächenbrand. Einer plumpen Parallelisierung redete Kennedy ebenso wenig das Wort wie Tuchman. Es ging vielmehr um politische Denkhaltungen und Einstellungsmuster von bemerkenswerter, auch durch Katastrophen nicht zu erschütternder Hartnäckigkeit.
Tatsächlich lassen sich die Reizthemen des Kalten Krieges in der politischen Grammatik des frühen 20. Jahrhunderts beschreiben: In beiden Epochen dominierte die Angst vor dem Verlust von Kriegsführungsfähigkeit, hier wie dort wurde ein überhitzter Kampf um Glaubwürdigkeit geführt. Und im einen wie im anderen Fall trieb man mit dem wichtigsten Kapital in der internationalen Politik Schindluder: Vertrauen wurde aufgebracht, Misstrauen gezüchtet. Derlei Fahrlässigkeit im Umgang mit Vertrauen erklärt nicht zuletzt die lange Dauer des Kalten Krieges. Genauer gesagt: das aus dem Ersten Weltkrieg sattsam bekannte Phänomen des „nicht aufhören Könnens“.
So überzeugend Barbara Tuchman die „long duree“ politischer Denkstile und Praktiken herausarbeitet, von Zwangsläufigkeit ist bei ihr keine Rede. Im Gegenteil. „August 1914“ läuft wie alle ihre Erzählungen auf die Pointe hinaus, dass alles zu jeder Zeit auch ganz anders hätte kommen können. Traditionen oder Strukturen rahmen eine Handlung, erklären aber nicht, wie innerhalb dieses Rahmens agiert und entschieden wird. Nuancen geben den Ausschlag, Zufälliges lenkt das Geschehen in eine unvorhersehbare Richtung, Unwahrscheinliches hebelt Erwartbares oder Selbstverständliches aus. Tuchmans Interpretation lebt also vom Ausloten des Überraschungspotentials und vom Vermessen der Offenheit.
Andererseits verweist Barbara Tuchman nachdrücklich auf die Grenzen des Zufälligen und Kontingenten. Indem sie zeigt, dass es eben nicht allein vom Zufall abhängt, ob Handlungsspielräume eröffnet, verengt oder geschlossen werden, dass auch in offenen Entscheidungssituationen am Ende immer noch entschieden wird und dass die auf Schwarz fallende Kugel nur deshalb ein Desaster auslöst, weil jemand vorher alles auf Rot gesetzt hat – indem sie dergleichen beharrlich im Bewusstsein hält, entwirft sie avant la lettre das Gegenmodell zu historiographischen Moden unserer Tage.
Mit einer Geschichtswissenschaft, die sich in der Beschwörung von Offenheit ergeht und aus Kontingenz eines essentialistischen Begriff macht, ohne über die Ironie dieses Vorgangs zu stolpern, hätte die Grand Dame aus den USA nichts anfangen können. Und Historiengemälde im Geiste der avantgardistischen Moderne, mit einer Vorliebe für konturlose Übergänge und schemenhafte Gestalten, waren ihr ohnehin fremd. Einem Streit aber wäre sie nicht aus dem Weg gegangen. Im Gegenteil. Sie hätte ihn mit spitzer Feder und großem Genuss geführt.
Prof. Dr. Bernd Greiner, Hamburger Institut für Sozialforschung,