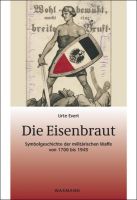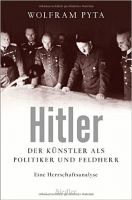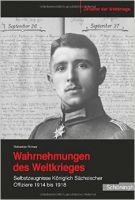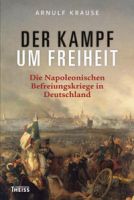Mentalität
Marnetté, Victor, M.A.
1. Amerikanischer Bürgerkrieg (1861–1865)
* Deutsche Soldaten im Krieg und Nachkrieg
* Schlachten, Operationsgeschichte
* Feldpost
2. Erster Weltkrieg
* Land-, See- und (besonders) Luftkrieg (dt. Sicht, beim Luftkrieg auch die britische, französische, russische und amerikanische Perspektive)
* (Counter-)Intelligence (besonders Amt IIIb)
* Feldpost
* Kriegsgefangene
* Kulturen der Gewalt
* Nachkrieg und Revolution
3. Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg:
* Waffen-SS
* Wehrmacht (Heer, GfP, Spezialeinheiten)
Brühöfener, Friederike, PhD
Neure und Neuste Geschichte, Geschlechtergeschichte, Kulturgeschichte, Militärgeschichte