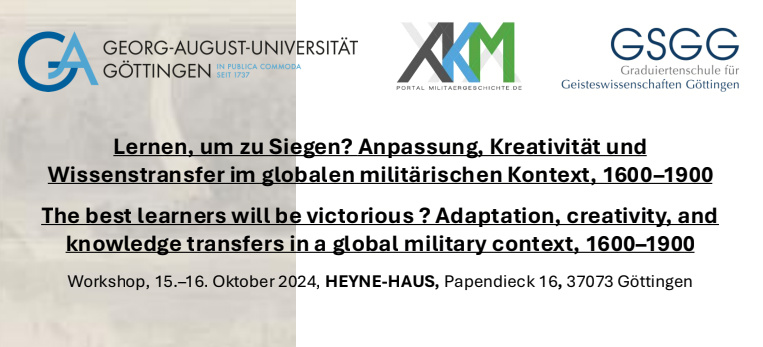Vom 15. bis zum 16. Oktober fand an der Georg-August-Universität in Göttingen der Workshop „Lernen, um zu siegen? Anpassung, Kreativität und Wissenstransfer im globalen militärischen Kontext, 1600–1900“ statt. Die Veranstaltung wurde von SARAH VON HAGEN (Göttingen) und SANDER GOVAERTS (Göttingen) organisiert und durch den Arbeitskreis Militärgeschichte e.V. sowie die Graduiertenschule für Geisteswissenschaften Göttingen finanziert. Im Zentrum stand die Frage, inwiefern Anpassungs- und Lernfähigkeit für den militärischen Erfolg entscheidend waren und wie Wissensproduktion und Wissenstransfer dabei eine Rolle spielten.
Den Auftakt des Workshops gab FELIX SIEGMUND (Bochum) mit einem Vortrag zum militärischen Wandel in Ostasien im langen 17. Jahrhundert. Anhand der Entwicklung und Standardisierung von militärischen Organisationssystemen in China und Korea sowie der Verbreitung von Feuerwaffen verdeutlichte Siegmund den Wissenstransfer und die Anpassungsstrategien, die im militärischen Kontext erfolgten. Siegmund betonte hierbei einen auffälligen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis: Trotz zahlreicher militärischer Veränderungen auf praktischer Ebene, sei in den militärischen Theorietexten eine erstaunliche Kontinuität festzustellen.
Im anschließenden Vortrag blickte JULIUS BECKER (Paris) ebenfalls auf den asiatischen Raum. Im Mittelpunkt des Vortrags standen die Erkenntnisse, welche deutsche Kriegsbeobachter aus dem Chinesisch-Japanischen (1894–1895) und Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) gewannen und die Rezeption dieses Wissens im Deutschen Reich. Auch wenn es eine grundsätzliche Lernbereitschaft auf technischer und operativer Ebene gegeben hätte, seien viele Erkenntnisse aufgrund nationaler Eitelkeiten sowie innen- und rüstungspolitischer Interessen verworfen und der Wissenstransfer dadurch eingeschränkt worden.
Zu Beginn des zweiten Panels schilderte ASTRID ACKERMANN (Jena) am Beispiel der Belagerung von Candia (1648–1669) die kriegsentscheidende Rolle von militärischer Infrastruktur und Logistik im 17. Jahrhundert. Basierend auf zeitgenössischer militärischer Fachliteratur konzentrierte sie sich darauf, welche logistischen Lerneffekte sich aus der Belagerung ergaben, was für Transformationsprozesse festzustellen sind und wie Fachwissen vermittelt wurde. Ackermann konstatierte, dass der „Fall Candia“ in der zeitgenössischen Literatur zwar zum Lehrbeispiel stilisiert wurde, dabei jedoch nicht die logistischen Aspekte, sondern Bau- und Befestigungsfragen im Mittelpunkt standen.
Anschließend widmete sich SANDER GOVAERTS (Göttingen) der kontinuierlichen Bedeutung von ethnobiologischem Wissen für die Streitkräfte von 1600–1900. Vor dem Hintergrund von Globalisierung und wissenschaftlicher Revolution erläuterte Govaerts verschiedene Gründe für die fortwährende Relevanz von nichtwissenschaftlichem Wissen über Tiere und Pflanzen und eröffnete damit eine neue Perspektive auf die Erforschung militärischen Wissens und militärischer (Umwelt )Anpassung.
ANKE FISCHER-KATTNER (München) begann das dritte Panel mit einem Forschungsüberblick zur Debatte über den zunehmenden militärischen Niedergang des Osmanischen Reichs nach 1700. In einer Gegenüberstellung verschiedener Forschungspositionen untersuchte sie mögliche Ursachen für die militärische Lernunfähigkeit sowie Anpassungsschwierigkeiten der Osmanen und legte den Schwerpunkt dabei auf die Belagerungstechnik und den Festungsbau.
Am Beispiel der „Šuvalov-Haubitzen“ wandte sich OTTO ERMAKOV (Göttingen) den taktisch-technischen Innovationen der russischen Armee im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) zu. Ermakov konzentrierte sich dabei auf die russische Geheimhaltung der neuen Geschützart und die Auswirkungen der unterdrückten Wissensweitergabe, die von russischer Seite gleichzeitig propagandistisch hervorgehoben wurde.
LOUIS SICKING (Amsterdam/Leiden) eröffnete mit seinem Vortrag das abschließende Panel des Workshops und richtete den Blick auf die maritime Kriegführung. Sicking veranschaulichte die Bedeutung der Galeerenkriegführung im langen 16. Jahrhundert und wandte sich dezidiert gegen die Behauptung, die technologischen Veränderungen in der europäischen frühneuzeitlichen Kriegsmarine seien revolutionär gewesen. Am Beispiel der Einführung schwerer Geschütze auf Galeeren plädierte Sicking nicht für den Revolutions-, sondern den Evolutionscharakter der technischen Veränderungen.
Der Vortrag von SARAH VON HAGEN (Göttingen) bildete den Abschluss des Workshops. Untersuchungsgegenstand war die englische Übersetzung von Paul Hostes Seekriegstraktat „L’art des Armées Navales“ (1697), erschienen im Jahr 1762, welches eines der ersten Seekriegstraktate in englischer Sprache darstellte. Vor dem Hintergrund, dass die Übersetzung nicht nur 65 Jahre später erschien, sondern auch zu einem Zeitpunkt, als die britische Marine der französischen als überlegen galt, untersuchte von Hagen mögliche Gründe für die Übersetzung sowie die praktischen Auswirkungen des Wissenstransfers auf die Seekriegstheorie.
Die zentrale Frage des Workshops, inwiefern Anpassung und Lernfähigkeit für den militärischen Erfolg entscheidend waren und wie Wissensproduktion und Wissenstransfer dabei einen Stellenwert einnahmen, zog sich als roter Faden durch alle Vorträge. Besonders positiv hervorzuheben ist hierbei der nicht nur europäische, sondern globalhistorische Rahmen und die methodisch vielfältigen Zugriffe auf das Thema. Von strukturalistischen Darstellungen über spezifische Fallstudien näherten sich die Vortragenden der Frage auf unterschiedliche Weise und zeigten so das umfassende Potential einer wissenstheoretischen Perspektive auf Krieg und Militär. Die ertragreichen Diskussionen der Teilnehmenden warfen schlussendlich eine neue Frage auf: Braucht das militärische Lernen den Krieg?
Tagungsprogramm Dienstag, 15.10.2024
Begrüßung und Einführung durch die Veranstaltenden
Sektion 1: Die Kunst des Krieges in Ostasien, Leitung: Sander Govaerts (Göttingen)
Felix Siegmund (Bochum): Militärischer Wandel in Ostasien im langen 17. Jahrhundert – Texte, Waffen und Ideen
Julius Becker (Paris): Von Japan Siegen Lernen? Europäische Kriegsbeobachter im Chinesisch-Japanischen und Russisch-Japanischen Krieg
Diskussion
Sektion 2: Infanterie gewinnt Schlachten, Logistik gewinnt Kriege? Leitung: Marian Füssel (Göttingen)
Astrid Ackermann (Jena): Lernen in der Logistik?
Sander Govaerts (Göttingen): Conquering Nature, Conquering the World: Environmental Adaptations in Armed Forces and the Limits of Scientific Knowledge, 1600–1900
Diskussion
Mittwoch, 16.10.2024 Begrüßung und Einführung Tag 2
Sektion 3: Wissen von und über Nachbarn? Leitung: Sarah von Hagen (Göttingen)
Anke Fischer-Kattner (München): Learning Difficulties? The Debate about the Backwardness of the Ottoman Empire
Otto Ermakov (Göttingen): Taktisch-technische Innovationen in der russischen Armee im Siebenjährigen Krieg (1756–1763)
Diskussion
Sektion 4: Lernen auf See, Leitung: Niels Petersen (Göttingen)
Louis Sicking (Amsterdam/Leiden): Continuity and adaptation: The importance of galley warfare in the long 16th century around Europe and beyond
Sarah von Hagen (Göttingen): „Confirmed By Experience“. English translations of naval theoretical treatises in the 18th century Diskussion
Abschluss und Zusammenfassung der Ergebnisse durch die Veranstaltenden